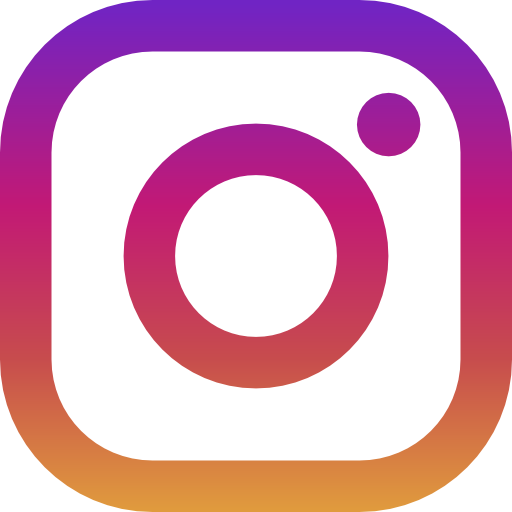Matter Matters, oder: Nichts als Farbe
Angela Stief
Direktorin Albertina modern
Farbe. Nichts als Farbe. In unterschiedlichen Nuancen und Kombinationen. Meistens sind es gedeckte Töne in grünlichen, gelblichen, rötlichen und bläulichen Schattierungen, die in ihrem subjektiven Ausdruckswert bewusst zurückgenommen wurden. Einmal ein ganz dunkler, fast schwarzer Ausreißer. Eine kontraststarke Betonung der Form, der Linienführung durch die Kontur, wenn sie sich von der Umgebung abhebt. Den Joker der Farbe, ihre ästhetische Eindringlichkeit und emotionale Überzeugungskraft, spielt Eduard Tauss nicht aus. Es ziehen den Betrachter weder schreiende Töne, wie man sie aus der Pop Art kennt, die sich der visuellen Sprache der Werbung anpasste, um die Masse zu gewinnen, noch die farbliche Sensationskraft, wie sie Künstler von Yves Klein über James Turrell bis Anish Kapoor erkundeten, in den Bann. Bei manchen Arbeiten denkt man an die monochromen Skulpturen von Angela de la Cruz und Hans Kupelwieser, die meistens mit industriell vorgefertigten Ausgangsmaterialien hantieren, die dann deformiert werden. Solche Vergleiche greifen jedoch zu kurz, da Tauss bei der Produktion seiner Objekte nie auf bereits bestehende materielle Versatzstücke zurückgreift.
Der Künstler, der sich in der Eleganz der Diskretion übt, ästhetische Superlative und auch eine apodiktische Begrifflichkeit meidet, vermischt flüssiges Polyurethan mit Pigmenten in gedämpftem Kolorit, kultiviert die Abtönung und nimmt den Effekt zurück, um die Aufmerksamkeit des Betrachters zu lenken. Trotz einer künstlerischen Haltung, die stets die Angemessenheit im Ausdruck sucht, schürt Tauss Zweifel: Einerseits konzentriert er sich auf die Ausschließlichkeit seines Mediums und andererseits verdeutlichen seine Arbeiten, dass es primär nicht um den Farbwert und um dessen langläufige Bedeutungshoheit geht: „Farbentscheidungen sind Differenzentscheidungen“,1 meint Tauss und negiert die Relevanz spezifischer Farbtöne, die ein Objekt „schlüssig machen“ und etwas anderes als eine Materialeigenschaft vermitteln. So kann beispielsweise die Farbskala von Haut von ganz hell über braun bis fast schwarz reichen und sagt dennoch kaum etwas über die ihr zugrundeliegende Materialität aus.
Die scheinbare Widersprüchlichkeit in der ästhetischen Aussage der Arbeit von Tauss – es geht um Farbe, aber doch nicht um Farbe (Farbe als Tonwert versus Farbe als Substanz) – schärft die Rezeption. Heinz Gappmayr schreibt: „Ihm geht es allerdings weniger um die höchst komplexe Realität der Farbe, sondern um den Prozess der Herstellung, um die Substanz des Materials, um die Beziehung zwischen Farbe und Stoff.”2 Farbe findet in seinem Oeuvre eine extraordinäre Anwendung. Er verwendet sie diametral entgegengesetzt zum malerischen Gewohnheitseffekt als mehr oder weniger dick aufgetragenes Medium, das figurative oder abstrakte Zeichen auf einen Bildträger wie eine Leinwand appliziert. Er schafft Materialgesten, Farbobjekte, die von flächigen – wenige Millimeter dicken – bis zu gänzlich plastischen Gebilden reichen. Dabei bedient er sich weder eines additiven (Plastik) noch eines subtraktiven (Skulptur) Verfahrens. Der Künstler bezeichnet die Werke meist selbstreferentiell als „Farbkörper“, „Farbfläche“, „Offene Form“, usw., je nach Beschaffenheit und Machart. Farbe und Form begreift er als enge Verbündete, die sich als Einheit im Objekt zusammenfinden und sich räumlich entfalten: „Die Autonomie der Farbe, ein Begriff, der im Kontext der gegenstandsfreien Malerei entstanden ist, erfährt hier seinen Fortgang: Die Farbe hat sich sogar von ihrem Bildträger befreit und macht sich mittels ihrer eigenen plastischen Substanz zum Ausdruck ihrer selbst und zum Gegenstand ihrer Betrachtung im Raum.”3 Die Farbe gewinnt dadurch maximale Autonomie und der Wiedererkennungswert dieser Objekte hat signatorische Kraft. Wenn man sie beschreibt, möchte man sich eines Vokabulars bedienen, das klingt, als wäre es der Textil- und Metallbranche entlehnt: Die Rede ist dann von Einstülpungen, Faltungen, Dellen, Schlieren, Ausbeulungen, Ausfransungen, Faltenwürfen, Drapierungen und zerknitterten Flächen in monochromer oder manchmal auch zweifarbiger Ausführung. Meistens sind es Abweichungen von geometrischen Axiomen und intakten Formen, die beim Betrachten Irritationen auslösen: „Formation und Deformation sind Gestaltungsmittel, die sich gegenseitig bedingen“4, sagt der Künstler. In seinem Werk erkennt man selten scharfe Kanten noch spitze Ecken, sondern unregelmäßige Reliefs, weiche Übergänge und organische Rundungen. Modulierte Flächen erzeugen spielerisch Volumen.
Es liegt auf der Hand, bei manchen dieser Objekte an die Skulpturen aus gepresstem Autoschrott von John Chamberlain oder die bemalten Kühlerhauben von Richard Prince zu denken. Doch ist diese erste Ähnlichkeit ein optischer Trugschluss. Bei Tauss geht es weder um die Wiederverwertung von ausrangierten Gütern noch um die Auseinandersetzung mit Alltagsobjekten und Klischees beziehungsweise Statussymbolen, sondern um die innovative Nutzung eines Materials, eine von ihrer Historie und ihrem applikativen Charakter befreite und nicht mehr an ihre exklusive Flächigkeit gebundene Materialansichtigkeit. Trotz oder gerade wegen ihrer Abstraktion setzen diese Skulpturen immer wieder Assoziationen frei und lassen bei bestimmten Werkserien an die Stofflichkeit von Decken und Kissen denken. Obwohl der Künstler sagt, dass ihn der Realismus nicht interessiere, und versucht, „bewusst keine gegenständlichen Zusammenhänge und Ähnlichkeiten mit Design und Natur herzustellen“5, sind verschiedene Assoziationen und Realbezüge nicht von der Hand zu weisen. Manche Arbeiten haben etwas Organisches, erinnern an Adern, Haut, Fleisch und den Mythos des gehäuteten Marsyas.
All diese Interpretationen widersprechen jedoch dem künstlerischen Anspruch auf Neutralität. Man sollte sie besser unterlassen, sie schwächen die Autonomie der Objekte, ihren Werkstatus – die Materialimmanenz. Manchmal ist es die Grundvoraussetzung für eine gelingende Rezeption, sich zu disziplinieren, in der Zurückweisung von voreiligen Analogien und, wenn man so will, sich in einem Willen zur Abstraktion zu üben und damit ein allzu verspieltes und funktionales Denken abzulehnen.
Man könnte Mutmaßungen über das Selbstverständnis von Eduard Tauss anstellen und sich fragen, ob er ein Maler ist, der sich bildhauerisch betätigt oder eher ein Bildhauer, der malt. Seit seinem Studium besteht die Faszination für den Werkstoff Plastik und seit seiner ersten Einzelausstellung beim Steirischen Herbst (1991) arbeitet er mit Kunstharz – zunächst Polyester, dann Polyurethan – und beschäftigt sich mit der Materialität des Mediums. Daraus hat sich ein stringentes Konzept entwickelt, das man als die Kunst der Farbform, als ein Erkunden der Aggregatzustände zwischen flüssig und fest beschreiben könnte. Neoplatonisch formuliert geht es um die Idee von Farbe, die ihren akzidentiellen Status verloren hat und in der Darstellung permanent an Substanz gewinnt. Pure Farbe, die keine Hybridisierungen mit anderen Materialien eingeht und deshalb auch für das Reinheitsgebot eines apollinischen Kunstverständnisses steht.
Das Oeuvre von Eduard Tauss folgt der Zielgeraden der L’art pour l’art. Es kommt ausschließlich um seiner selbst willen zur Geltung. Den Diensten an der gesellschaftlichen Integration oder Exklusion, der politischen Verbesserung, der Meinungsbildung, dem Anspruch zu informieren oder irgendeiner wie auch immer gearteten stilistischen oder ideologischen Verpflichtung ist die Kunst hier enthoben. Tauss negiert die sowieso viel zu langen kunsthistorischen Narrative des Abbildens, Aneignens, Assemblierens, Bricolierens, Recycelns und Zitierens. Seine künstlerische Lösung entfaltet sich in der materialästhetischen Reduktion und gerät trotzdem nie in den Verdacht des Fetischismus. Den ergebnisoffenen Arbeitsprozess versteht Tauss als Allianz mit dem Material. Ein ständiges Lernen vom Medium und mit ihm, ein Durchformulieren von Materialmöglichkeiten. In der Wiederholung von räumlich ausladenden Skulpturen, planen Werken, die an das Bildgeviert erinnern, und Arbeiten, die auf einem im Atelier gespannten Draht aushärten, schafft er Ordnungskategorien in unterschiedlich raumgreifenden Varianten. Diese Serialität ohne zwangsläufige Chronologie strukturiert das Oeuvre. Die glatten Oberflächen reflektieren das von Außen einfallende Licht, so als wollten sie auf ihre spezifische Eigenart verweisen, Denkprozesse in Gang setzen, sich im Spannungsfeld von x-beliebigen zeitgenössischen künstlerischen Ansätzen und individuellem Tun als herausragende Lösung behaupten. Der Glanz, der ihnen anhaftet, ist meist gebrochen: „Ich strebe keine perfekten Oberflächen an, sondern erlaube dem Zufall mich zu überraschen.“6 Das eigentlich ganz simple, aber dennoch nie praktizierte Konzept der Visualisierung von Farbe während des Formfindungsprozesses, die Untersuchung des Spannungsverhaltens und der Fragilität von Form sieht vor, die auktoriale Kontrolle während der Produktion einzuschränken. Die abstrakt-expressive Geste des Künstlers, das Schütten der Farbe, markiert die Akzentverschiebung vom statischen Werk zur Performanz der Herstellung und die Transformation eines klassischen Gussverfahrens.
Der Impuls, also die Menge an Bewegung, die auf das unfertige Objekt sowohl seitens des Künstlers als auch durch die Schwerkraft einwirkt, beschreibt die unmittelbare, in der Zeit verdichtete Interaktion von Künstler und Material: Tauss gießt das flüssige Kunstharz unter Berücksichtigung von Materialstärke und Ausdehnung flächig auf eine auf dem Boden liegende Plastikfolie. Wenn das Material „weitestgehend trocken, aber noch nicht ausgehärtet ist“7, beginnt die Arbeit des Hängens, Biegens und Formens. Dabei beträgt die Reaktionszeit des Künstlers nur wenige Minuten. Danach gibt es keine Möglichkeit der Nachbearbeitung mehr. Die ganze Konzentration liegt in dieser Zeit darauf, „das Material zu seinem Eigenwert kommen zu lassen“8 – ein Paradigma der künstlerischen Entwicklungen der 1960er-Jahre, in denen Materie, Material und Materialitäten gleichermaßen Ausgangspunkt und Inhalt künstlerischer Produktion wurden. So standen etwa in der Minimal Art und bei Künstlern wie Robert Morris und Franz Erhard Walther die spezifischen Eigenschaften des jeweiligen Materials im Vordergrund. Auch Tauss will das Verhalten des Materials, wenn es trocken wird, Versehen, die während der Produktion entstehen, und die Endfarbigkeit der Objekte nur bedingt beeinflussen. Auch die Wahl von Vorder- und Rückseite passiert erst während des Arbeitsprozesses. Die Farbmasse wird während des Härtungsprozesses von der Schwerkraft moduliert: Sie wird ansichtig, wenn sie rinnt, verläuft, absackt und Falten wirft. Es sind dann Falten, manchmal auch Spalten und Knicke bis hin zu Brüchen, die die Werke bestimmen.
Letztendlich entfalten die Arbeiten des wohl klassischen White-Cube-Künstlers Eduard Tauss ihre Wirkungsmacht im Display. Die Modalitäten der Präsentation sind variabel und das breite Darstellungsspektrum reicht von Bodenobjekten bis zu Arbeiten, die lehnen, auf einem Podest liegen und an der Wand hängen. Es geht um vieles in dieser Kunst: um eine nicht-affirmative Ästhetisierung des Mediums, um das Einwirken physikalischer Kräfte während der Produktion, um Strukturaufweichung und um die Tautologie des Zähflüssigen. Aber vor allem geht es auch um eine sich im Raum entfaltende Malerei, die das Momentum der Interaktion zwischen Künstler und Material inszeniert.
___________________________________________________________________________
1 Angela Stief im Gespräch mit Eduard Tauss im Atelier des Künstlers, Juni 2017, Wien.
2 Heinz Gappmayr, Katalog: Eduard Tauss, Wien, edition ps, 2003, S. 14.
3 Michael Post, Heiner Thiel, „Zu den Farbkörpern von Eduard Tauss“, im Ausst.kat.: Embodying Colour, Kunsthalle Wiesbaden, Edition PT, 2013, S. 67.
4 Ebenda, siehe FN1.
5 Ebenda.
6 Ebenda, siehe FN1.
7 Ebenda.
8 Ebenda, siehe FN1.
Matter Matters, or: Nothing but Paint
Angela Stief
Director Albertina modern
Paint. Nothing but paint. In various nuances and combinations. Usually they are subdued hues, in greenish, yellowish, reddish and bluish shades that were consciously scaled back in their subjective expressive value. Occasionally a very dark, nearly black outlier. A contrast-rich emphasis on the form, of the line through the contour when it stands out against its surroundings. Eduard Tauss doesn’t resort to playing the joker card of colour, with its aesthetic forcefulness and emotional persuasiveness. The viewer is captivated neither by screaming colours familiar to us from Pop Art – which adopted the visual language of advertising to win over the masses – nor by the sensational colouristic power explored by artists from Yves Klein and James Turrell to Anish Kapoor. Some works bring to mind the monochrome sculptures of Angela de la Cruz and Hans Kupelwieser, who generally make use of industrially prefabricated materials that are then deformed. But these kinds of comparisons fall short because in producing his objects, Tauss never resorts to the use of existing material components.
Eduard Tauss, who exercises the elegance of discretion and avoids both aesthetic superlatives and an apodictic terminology, blends liquid polyurethane with pigments of muted colouring, refines the shading and reduces the effect in order to guide the viewer’s attention. Despite an artistic attitude that constantly seeks appropriateness in expression, Tauss sows doubt: on the one hand he concentrates on the exclusivity of his medium, but on the other his works demonstrate that the primary concern is not the colour value and its long-time sovereignty of importance: “Decisions of colour are decisions of difference”1 , says Tauss, negating the relevance of specific hues that make an object “coherent” and convey something other than a material quality. The colour scale of skin, for example, can range from very light to brown to nearly black, but it still says little about its underlying materiality.
The apparent contradiction in the aesthetic message of Tauss’s work – it’s about colour but then again not about colour (colour as chromatic value as opposed to colour as substance) – sharpens the reception. As Heinz Gappmayr wrote: “He is less concerned with the highly complex reality of colour than he is with the process of production, with the substance of the material, with the relationship between colour and material.”2 Colour is utilized in an extraordinary manner in Tauss’s oeuvre. He uses it in a way that is diametrically opposed to the habitual painterly manner of a more or less thickly applied medium that affixes figurative or abstract characters to an image carrier such as a canvas. He creates material gestures, colour objects that range from flat – only a few millimetres thick – to completely sculptural figures. In doing so he resorts neither to an additive (modelling) nor to a subtractive (carving) process. The artist usually gives the works self-referential names such as “Colour Body”, “Colour Plane”, “Open Shape”, etc., depending on their qualities and style. He regards colour and form as close allies that unify in the object and develop spatially: “The autonomy of colour, a concept that emerged in the context of non-figurative painting, is carried on here: colour has even liberated itself from its image carrier and through its own plastic substance becomes an expression of itself and an object of examination in space.”3 Colour thereby gains maximal autonomy, and the memorability of these objects has the power of a signature. In describing them, one is tempted to use a vocabulary that sounds as if it were borrowed from the field of textiles and metals: one then speaks of invaginations, folds, indentations, smudges, bulges, burrs, fold falls, draperies and wrinkled surfaces in monochrome and sometimes even bichrome executions. Generally it is the departures from geometric axioms and intact forms that cause confusion on the part of viewers: “Formation and deformation are artistic means that are mutually dependent”4, says the artist. In his works one seldom perceives sharp edges or pointed corners but rather irregular reliefs, soft transitions and organic curves. Modulated surfaces produce volume in a playful manner.
It is not surprising that some of these objects bring to mind John Chamberlain’s sculptures made of crushed automobile parts or Richard Prince’s painted car hoods. But this initial resemblance is a visual deception. Tauss is concerned neither with recycling scrapped goods nor with the study of everyday objects, clichés or status symbols. What interests him is the innovative utilization of a material, a material visibility that has been liberated from its history and its applicative character and is no longer bound to its exclusive flatness. Despite or because of their abstraction, these sculptures repeatedly trigger associations and in the case of certain work series bring to mind the materiality of blankets and pillows. Although the artist insists he is not interested in realism and consciously avoids “producing figurative relationships and similarities to design and nature”5, various associations and references to reality cannot be denied. Some works have an organic nature and are reminiscent of veins, skin, flesh and the myth of the flayed Marsyas.
All of these interpretations, however, contradict the artistic demand for neutrality. One would do better to abstain from them, as they weaken the autonomy of the objects, their work status – their material immanence. Sometimes the basic prerequisite for the successful reception of a work is to discipline oneself, to repudiate premature analogies and to strive, as it were, to accept abstraction and thus reject an overly playful and functional thought process.
One could speculate about Eduard Tauss’s self-conception and wonder if he is a painter who sculpts or rather a sculptor who paints. Even as a student he was fascinated by plastic materials, and since his first solo exhibition at the Steirischer Herbst (1991) he has worked with synthetic resin – first with polyester, then with polyurethane – and studied the materiality of this medium. From this a stringent concept developed that one could describe as the art of the colour form, as an exploration of the aggregate states between liquid and solid. Put in Neoplatonic terms, it is about the idea of colour that has lost its accidental status and constantly gains in substance in the display – pure paint that is not subjected to any hybridization with other materials and thus stands for the purity requirement of an Apollonian conception of art.
Eduard Tauss’s oeuvre follows the finishing straight of l’art pour l’art: his works are visually effective purely for their own sake. Here, art is absolved of its service to social integration or exclusion, to political betterment, to opinion-forming; it is absolved of its requirement to inform and of any other kind of stylistic or ideological obligation. Tauss negates what is in any case a much too long-lived art-historical narrative of depiction, acquisition, assemblage, bricolage, recycling and citation. His artistic solution develops the material-aesthetic reduction, but without ever coming under suspicion of fetishism. Tauss views the open-ended work process as an alliance with the material, as a perpetual process of learning with and from the medium, as a systematic formulation of material related possibilities. In the repetition of spatially expansive sculptures, of flat works reminiscent of the square picture, of objects hardening on a wire hanging in the studio, he creates ordering categories of differently sized variants. This serialism without a compulsory chronology is what gives the oeuvre structure. The smooth surfaces reflect the light falling from outside as if they wanted to point out their own specific uniqueness, set thought processes in motion, assert themselves as the exceptional solution in the field of innumerable contemporary artistic approaches and individual actions. The sheen inherent in them is usually broken: “I do not strive to create perfect surfaces; rather, I allow chance to surprise me.”6 The actually quite simple but nonetheless never practised concept of visualising colour during the form-finding process, of investigating the stress behaviour and fragility of form, demands the restriction of authorial control during the production. The artist’s abstractly expressive gesture, the pouring on of the paint, marks the shift of emphasis from a static work to a performance of the production and the transformation of a classic casting process.
The impulse – that is, the amount of movement by the artist as well as through gravity that impacts the unfinished object – describes the immediate interaction, condensed with regard to time, of artist and material: Tauss pours the liquid synthetic resin onto a plastic sheet on the floor, allowing for material thickness and expansion. When the material is “as dry as possible but has not yet hardened”7, the work of hanging, bending and forming begins. Here, the artist is allowed only a few minutes of reaction time. Afterwards, post-processing is no longer possible. During this time the entire concentration is focussed on “allowing the material to realize its own intrinsic value”8 – a paradigm of the artistic development of the 1960s, when matter, material and materiality became both departure point and content of artistic production. In Minimal Art, for example, and with artists such as Robert Morris and Franz Erhard Walther, the specific qualities of the respective material were in the foreground. Tauss, as well, wants to have only limited influence on the behaviour of the material when it dries, on oversights that occur during production, and on the final colouring of the objects. The choice of front and back side is also made only in the course of the work process. The colour mass is modulated during the hardening process by gravity: It takes on a visual form when it drips, runs, sags and wrinkles. Then it is the folds, sometimes also crevices and kinks or even breaks, that determine the works.
Ultimately the works by Eduard Tauss, undoubtedly a classic White Cube artist, develop their full impact when displayed. The modalities of presentation are variable, the broad representational spectrum ranging from floor objects to works that lean, lie on a pedestal and hang on the wall. This art is concerned with many things: with a non-affirmative aestheticization of the medium, with an impacting of physical forces during production, with a softening of structure and with the tautology of the viscous. But above all it is concerned with painting that unfolds in the space, painting that stages the momentum of the interaction between artist and material.
___________________________________________________________________________
1 Angela Stief in conversation with Eduard Tauss in the artist´s studio, June 2017, Vienna.
2 Heinz Gappmayr,: Eduard Tauss, exhibition cataloq, edition ps, Vienna, 2003, p. 14.
3 Michael Post, Heiner Thiel, „On the Colour Bodies by Eduard Tauss“, exh. cat..: Embodying Colour, Kunsthalle Wiesbaden, Edition PT, 2013, p. 67.
4 Angela Stief in conversation with Eduard Tauss in the artist´s studio, June 2017, Vienna.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Angela Stief in conversation with Eduard Tauss in the artist´s studio, June 2017, Vienna.
8 Ibid.